Kann man die drohende Insolvenz aufgrund der anhaltenden Corona-Krise noch abwehren? Eine Frage, die sich derzeit viele Unternehmen und Selbstständige stellen. Genau jetzt könnte sich die Digitalisierung als Retter in der Not erweisen.
Wie das funktionieren kann und welche Maßnahmen eine drohende Insolvenz verhindern können, erfahren Sie bei uns.
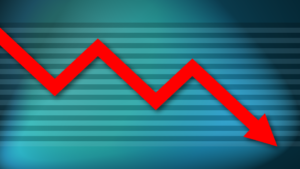
Viele Unternehmen beklagen sich über die drohende Insolvenz durch die Corona-Krise. Bild: Pixabay/iXimus
Vielen Unternehmen droht die Insolvenz
Dass nach der Corona-Pandemie nichts mehr sein wird, wie es einmal war, ist vielen Unternehmern schon lange klar. Dennoch haben nicht wenige Betriebe die Auswirkungen der weltweiten Lockdowns unterschätzt. Vor allem Unternehmen, die nicht über großzügige Rücklagen verfügen und/oder nicht in der eigenen, abbezahlten Immobilie tätig sind, sehen sich über kurz oder lang von der Insolvenz bedroht.
Wirtschaftsexperten gehen dabei davon aus, dass die Anzahl der Insolvenz-Anmeldungen ab dem Herbst 2020 noch einmal richtig ansteigen wird. Erst dann werden – so die Meinung – die Auswirkungen der Corona-Krise so richtig deutlich. Besonders hart trifft es die Tourismus-Branche, die Gastronomie und natürlich den Einzelhandel. Allein für diesen prognostizieren Wirtschaftswissenschaftler noch ungefähr 50.000 Insolvenzen.
Drohende Insolvenz – wer kann sie noch abwenden?
Die ersten großen Konzerne hat es bereits erwischt. Die Lufthansa konnte nur durch eine staatliche Beteiligung von 9 Milliarden Euro gerettet werden, die Warenhausgruppe Galeria Kaufhof/Karstadt hat bereits kapituliert. Vor allem das letzte Beispiel kann aber gut dazu dienen, ein Verständnis für die Relevanz der Digitalisierung zu entwickeln. Denn die großen Kaufhäuser waren schon vor der Corona-Krise alles andere als wirtschaftlich gesund. Aber warum?
Jetzt, wo es zu spät ist, beklagen viele Menschen die aussterbenden Innenstädte. Aber wer trägt am Ende wirklich die Schuld daran? Das Virus jedenfalls nicht. Sind es die Endkunden selbst, die zwar gerne durch die Häuser bummelten, dann aber doch im Internet kauften? Oder trägt auch der angestaubte Konzern die Verantwortung, der nicht nur den Einstieg in den Online-Handel verschlief, sondern auch die Häuser vor Ort vernachlässigte, die in keinster Weise ein „Einkaufserlebnis“ boten, welches die Kunden zum Kauf animierte?
Fakt ist: Wer die Chancen der Digitalisierung nicht nutzt und gleichzeitig auch am Point of Sale (POS) keine positiven Veränderungen zulässt, maximiert sein Insolvenzrisiko ganz allein.

Mit umfassenden Wirtschaftshilfen will die Regierung Insolvenzen durch das Coronavirus verhindern. Bild: Pixabay/PublicDomainPictures
Staatliche Unterstützungsmaßnahmen, Sofort-Hilfen und Rettungsschirme
Vater Staat lässt die Wirtschaft nicht hängen, das machten Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier gleich zu Beginn der Krise deutlich. Mit umfassenden Maßnahmen wie den Sofort-Hilfen, günstigen KfW-Krediten und Zuschüssen sollte die drohende Insolvenz von vielen Betrieben abgewendet werden.
Schnell stand aber fest: Auch wenn sich die Regierung noch so großzügig zeigt, es reicht nicht für alle. Und irgendwann müssen auch wieder die Deckel auf die staatlichen Töpfe, um noch Schlimmeres zu vermeiden. Es bleibt also dabei: Vor allem die Unternehmer selbst müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln. Wie das aussehen kann, erfahren Sie in diesem Artikel.
Insolvenzverfahren: Sonderregelung im Zuge von COVID-19
Zunächst einmal gilt: Wer feststellt, dass sein Betrieb in die Zahlungsunfähigkeit rutscht, muss das sofort melden. Ansonsten droht eine Anzeige wegen Insolvenzverschleppung. Spätestens drei Wochen nach Feststellung der Zahlungsunfähigkeit beziehungsweise Überschuldung muss der Antrag gestellt sein. Wichtig dabei: Wer trotz drohender Insolvenz noch Gelder in das Unternehmen pumpt oder andere Gläubiger bedient, kann im Insolvenzverfahren mit seinem Privatvermögen haftbar gemacht werden.
Tatsächlich aber gilt aktuell durch das Covid-19-Insolvenzaussetzungsgesetz (COVInsAG), dass die Pflicht zum Eigenantrag rückwirkend vom 01.03.2020 bis einschließlich zum 01.09.2020 komplett ausgesetzt ist. Diese „Schonfrist“ wird eventuell sogar noch einmal bis zum 31.03.2021 verlängert. Unternehmen soll dadurch Zeit gegeben werden, die Sanierung ihre Betriebs in Angriff zu nehmen. Aber Achtung: Diese Sonderreglung gilt ausschließlich für Unternehmen, die im Zuge der Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schieflage geraten sind!
Eine weitere Alternative kann das Schutzschirmverfahren sein. Ist Ihre Firma kurz- oder mittelfristig voraussichtlich noch zahlungs- und sanierungsfähig, bietet sich das so genannte Schutzschirmverfahren (§ 270b InsO) an.

Büro-Ausstattung mieten – das geht mit unserem Modern-Workplace-Modell. Bild: Unsplash/Luke Peters
Pause nutzen, Digitalisierung vorantreiben
Gerade jetzt sollten Unternehmen die Zeit nutzen, verstärkt in die Digitalisierung ihrer Prozesse und ihres Geschäftsmodells zu investieren. Nutzen Sie die Fristverlängerung sinnvoll, stellen Sie die alten Zöpfe auf den Prüfstand und nehmen Sie an entscheidender Stelle die Schere zur Hand. Nehmen Sie Kontakt zu Ihren wichtigsten Kunden und Lieferanten auf, sprechen Sie mit Ihrer Hausbank.
Unser Tipp: Solange die Zukunft ungewiss ist, müssen Sie keine harten Investitionen vornehmen. So können Sie beispielsweise neue Soft- und Hardware für Ihre Mitarbeiter zunächst einmal nur mieten. Flexible Laufzeiten und transparente Modelle ermöglichen Ihnen dabei eine hohe Skalierbarkeit.
Am Ende des Tages müssen Sie es schaffen, Ihren Kunden einzigartige Leistungen und Services zu bieten. Ob stationär, online oder mit einer Mischung aus beidem. Aber das galt auch schon vor der Corona-Krise – und die Digitalisierung kann Ihnen dabei mehr als helfen.
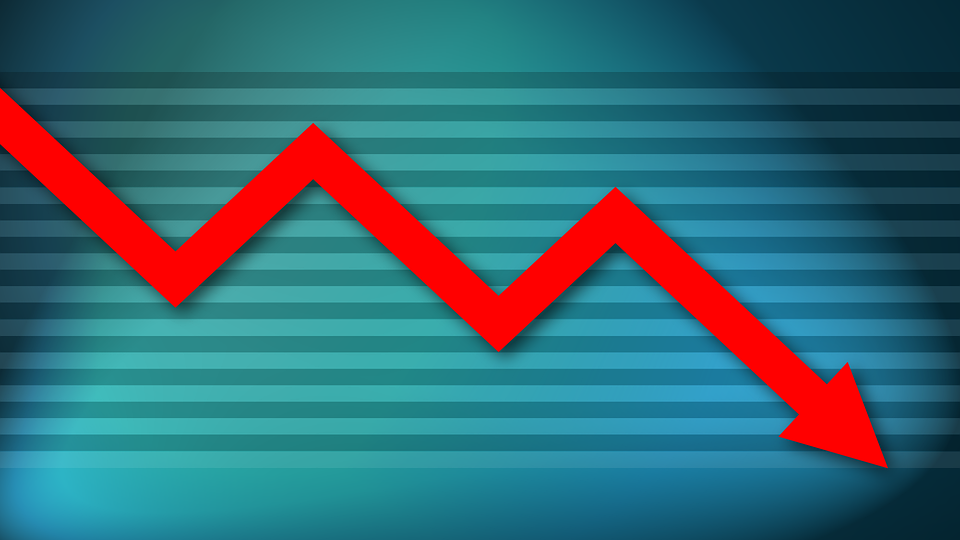

Schreiben Sie einen Kommentar
* = Pflichtfelder
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung